Veröffentlicht am 7. August 2019
Aktualisiert am 8. Januar 2024
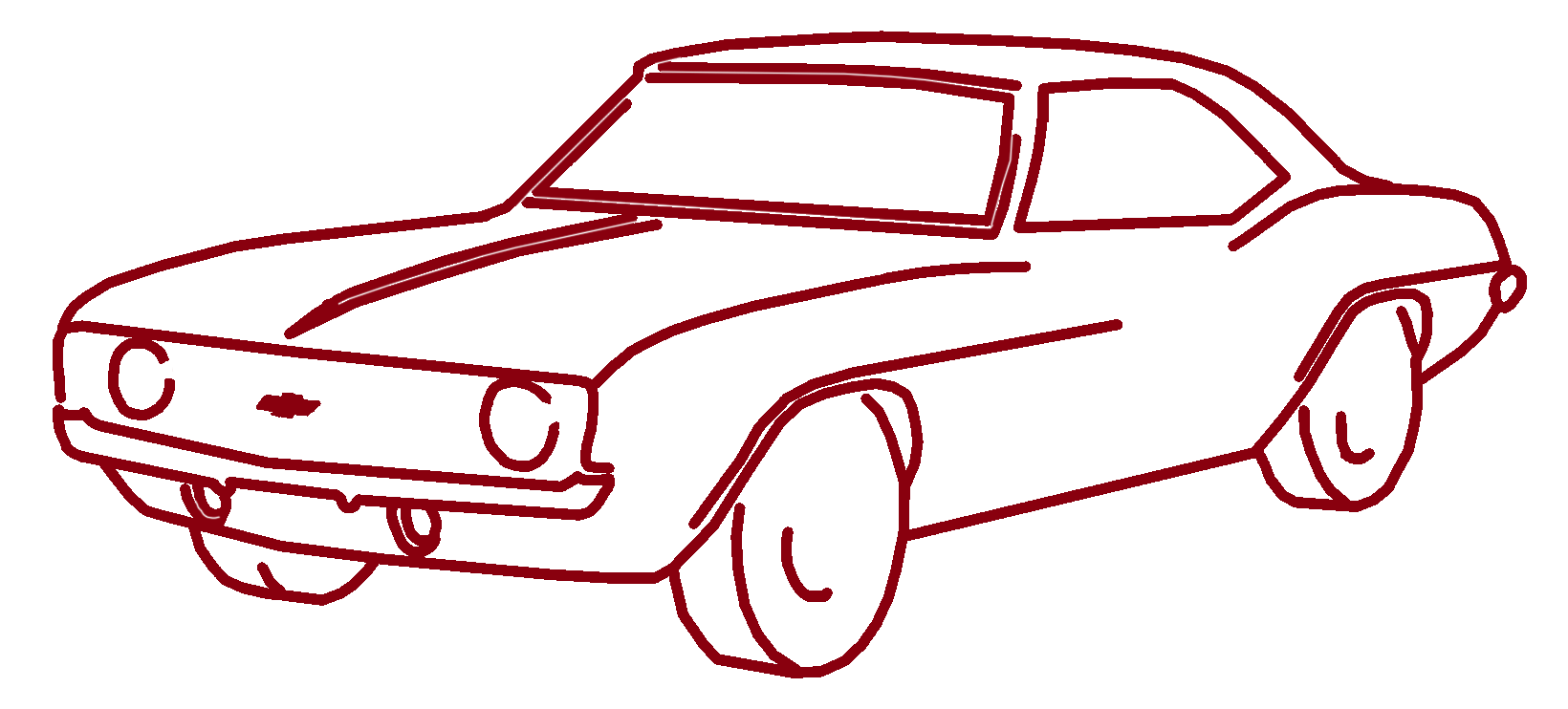
Auf diesen Seiten habe ich umfassende Informationen zusammengestellt, die für die Restauration, Verbesserung und Reparatur meines Autos erforderlich waren und weiterhin relevant sind.
Es ist entscheidend zu betonen, dass mein Camaro kein makelloses Sammlerstück aus einer Ausstellung ist. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, hat er nicht mehr seine originale Ausstattung. Daher ergibt es wenig Sinn, krampfhaft die „Originalität“ um jeden Preis zu bewahren.
Ich zitiere mal:
Camaros wurden zu einer Zeit in Massenproduktion hergestellt, als es darum ging, so viele Autos wie möglich zu bauen, ohne sich Gedanken über die Einheitlichkeit von einem Auto auf dem Fließband zum nächsten zu machen. Für jedes Auto, das genau in die Parameter dessen, was als „richtig“ gilt, passt, gibt es mindestens zwei, die es nicht tun, aber genauso original sind wie an dem Tag, als sie vom Band rollten.
„Camaro Restoration Guide 1967-1969“, Motorbooks, 1997. ISBN: 978-0-7603-0160-9, Seite 7
Der Autor Jason Scott vom Restoration Guide beschreibt in seinem Buch auch die Vorgehensweise zur Restauration. Unter Anderem wird eine Checkliste abgebildet, in der dann die benötigten Teile und die kalkulierten Arbeitsstunden eingetragen werden sollen. Also alles, was der „Restaurator“ meint zu benötigen.
Jetzt kommt es: Am Ende der Liste soll man die Preise vom Material verdoppeln und die Arbeitsstunden verdreifachen. Das betrifft auch das Werkzeug. Ich habe bereits über 1000 EUR in extra Werkzeug und Hilfsstoffe investiert. Mit dieser „Rechnung“ bekommt man dann einen realen Überblick der benötigten Kosten und Zeit.
Da mein Camaro keine besondere Ausstattung hat und kein besonderes Modell ist, wird sein Marktwert voraussichtlich nie besonders hoch sein. Daher ist es umso wichtiger, sich auf sinnvolle Maßnahmen zu beschränken. Es macht eben keinen Sinn, den realen Wert des Fahrzeuges durch Restaurationsmaßnahmen um ein vielfaches zu überschreiten. Mein Camaro war das typische „Hausfrauenauto“ mit kleinstem V8-Motor, Automatikgetriebe, ohne Klimaanlage, mit roten Sitzen und weißem Dach.
Wichtig ist der Erhalt des Zustand, die Fahrbarkeit und eine gute Optik.
Z/28
Beim Kauf präsentiert sich unser „Cooper“ als ein Chevrolet Camaro Z/28. Die Z/28-Modelle gelten als straßentaugliche Rennwagen und erfüllen den Traum vieler Enthusiasten. Die Produktion begann 1967, da nur frei verkäufliche Fahrzeuge an der amerikanischen Trans Am Rennserie teilnehmen durften.
Der Clone
Jedoch trägt unser Fahrzeug lediglich die Embleme und wird daher als „Clone“ bezeichnet. In den USA werden solche Fahrzeuge oft als „Tribute“ verkauft, was weniger abwertend klingt.
„Clone“ sind Fahrzeuge, welche einem bestimmten Model oder einer Ausstattungslinie nachempfunden werden. Bei Chevrolet werden sämtliche Ausführungen des „SS“ = Super Sport, „RS“ = Rally Sport oder „Z/28“ kopiert.

Z/28 steht ursprünglich für den Ausstattungscode RPO Z28 der Preisliste, von dem 1969 nur rund 21.000 Stück gebaut wurden. Der RPO Z28 beinhaltete einen speziellen 302 in3 Motor (in3 = Kubikinch und entspricht rund 4,9 Liter Hubraum), ein 4-Gang-Schaltgetriebe, Scheibenbremsen und andere leistungsfördernde Extras. Bei Clonen werden äußere Karosseriedetails wie Motorhauben, Scheinwerfer, Räder und Embleme, selbst das Armaturenbrett und die Sitze montiert. Das Ganze geht soweit, dass auch Motoren und Getriebe verpflanzt werden (nennt man „swapping“). Teilweise sind die „Fälschungen“ so gut gemacht, dass man die Fahrzeuge auf den ersten Blick nicht entlarvt. Erst die Fahrgestellnummer oder andere Details wie die Cowl Tag geben Aufschluss.
Doch nur Basis
Anhand der Cowl Tag ließ sich schnell ermitteln, dass der Cooper kein Z/28 ist. Auch sonst kein Sondermodell, nur die reine Basis.
Da ich nicht der typische Blender bin, rüste ich die Embleme zurück auf Ursprung. In 2021 lasse ich den Cooper komplett lackieren. Damit verliert er auch die Streifen und Spoiler an Front und Heck.


Die Farben sind annährend gleich. Durch den Lichteinfall (links Wolken, rechts Sonnenschein) erscheint er heller Rot.